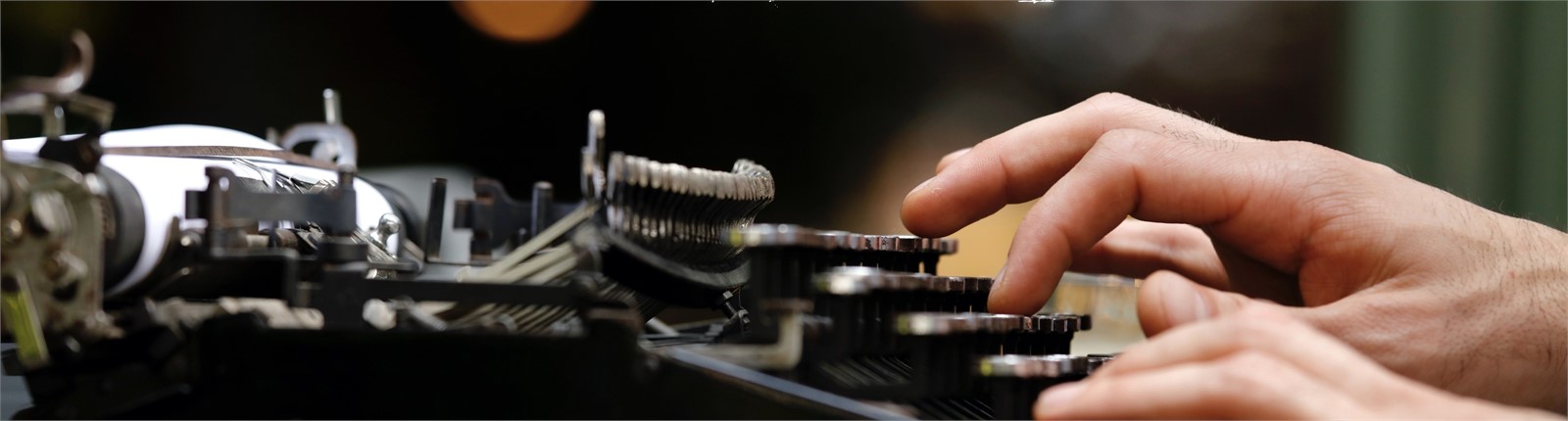
«Bleib doch einfach liegen. Mit unserem Verdunklungsrollo FYRTUR kannst du deine Gardinen gleich vom Bett aus steuern.» So spricht seit Jahren nur einer - IKEA. Das schwedische Möbelhaus setzt Corporate Wording gekonnt als Wiedererkennungsmerkmal ein: klar, frech, nutzenorientiert und konsequent in der Du-Form, so wie das in Schweden üblich ist. Auch in der Schweiz prüfen immer mehr Unternehmen die Du-Form. Doch will die Mehrzahl der Kundinnen und Kunden geduzt werden? Das steht je nach Branche und Zielgruppen auf einem ganz anderen Blatt. Was beispielsweise in Jugendherbergen funktioniert, irritiert in der Luxushotellerie. Zudem gibt es in der kleinen Schweiz grosse kulturelle Unterschiede. Wer seine Kundinnen und Kunden im deutschsprachigen Raum mit Du anspricht, ist gut beraten, in der Romandie weiterhin die Höflichkeitsform zu verwenden.
So entwickeln Sie Ihr eigenes Corporate Wording
Schritt 1: Analysieren Sie die verwendete Unternehmenssprache
Das Corporate Wording als Teil der Corporate Identity muss zum Gesamtauftritt Ihres Unternehmens passen. Überprüfen Sie die kommunikative Leitidee. Diese bestimmt, wie Sie mit wichtigen Dialoggruppen über Ihr Unternehmen, Ihre Marken, Dienstleistungen und Produkte kommunizieren. Die kommunikative Leitidee orchestriert ihre gesamte Unternehmenskommunikation: vom Claim bis zur Print- und Online-Kommunikation. Sie dient deshalb als Vorgabe für Ihr Corporate Wording.
Schritt 2: Definieren Sie den neuen Soll-Zustand
Wie soll Ihr Unternehmen künftig sprechen? Entwickeln Sie einen Sprachstil, der zum Unternehmen passt. Und der die Bedürfnisse, Erfahrungen und Emotionen Ihrer Dialoggruppen anspricht. Stellen Sie sich diese Fragen:
Schritt 3: Halten Sie das neue Corporate Wording in einem Regelwerk fest
Sie haben auf der Basis einer sorgfältigen Analyse die neuen Schreib- und Stilregeln, Love-Words und No-Words festgelegt. Halten Sie nun in einem Corporate Wording Guide das Regelwerk fest. Welche Themen Sie regeln sollten, zeigt Ihnen unser Beitrag «Corporate Wording Guide: So regeln Sie Ihre Unternehmenssprache».
Schritt 4: Informieren Sie Mitarbeitende und Dritte
Je grösser ein Unternehmen, desto mehr Menschen prägen mit ihrem Sprachstil das Image Ihres Unternehmens oder Ihrer Marke. Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeitenden den Corporate Wording Guide kennen und anwenden. Das Regelwerk sollte online schnell und einfach zugänglich sein. Vergessen Sie nicht, das PDF-File auch involvierten Textagenturen und Übersetzungsbüros anzubieten.
Last but not least: Der Sprachstil ist nur stimmig, wenn er überall angewendet wird. Auf Broschüren, Anzeigen, Online-Medien oder etwa bei Referaten. Da machen Korrespondenz und Briefverkehr keine Ausnahme. Denn sperrige Kundenbriefe passen so gar nicht zur flotten Werbesprache in Broschüren und auf Webseiten!
Das könnte Sie auch interessieren:
Sie wollen Sprache konsequent einsetzen und Eindruck hinterlassen? Wir sorgen für den feinen Unterschied.
Kontakt